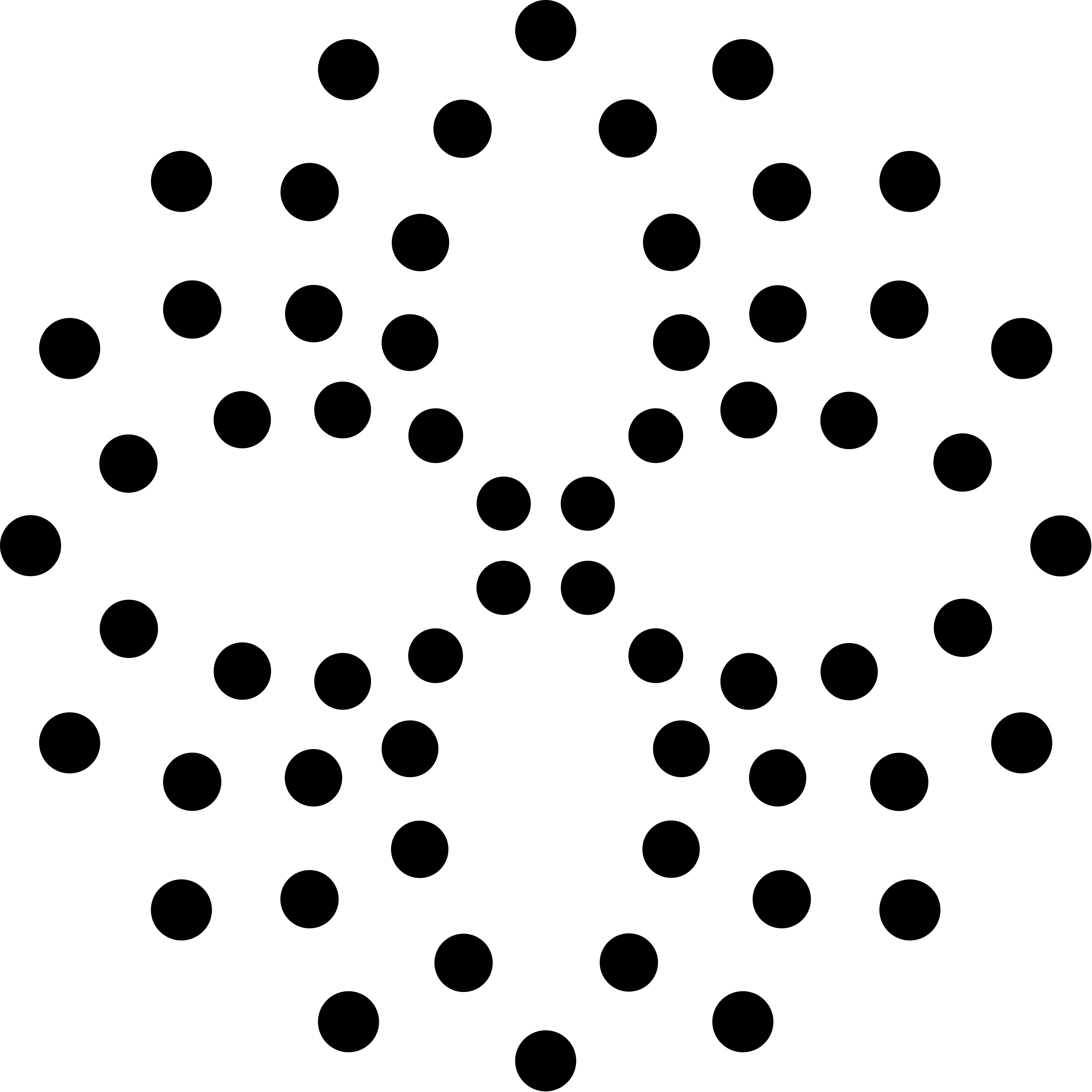für die Woche vom 22. bis zum 28. Februar
Predigt am Sonntag, 22. Februar, über 1. Mose 3, 1-19,
von Pfarrer Walter Neunhoeffer
Liebe Gemeinde,
unser jüngster Sohn war als kleiner Junge sehr sensibel und fühlte sich schnell für alles mögliche verantwortlich. Umso lieber spielte er „armes blindes Mäuschen“, das für nichts verantwortlich war, das einfach nur da sein durfte und in den Armen der Eltern kuscheln konnte.
Ich kann das Spiel des kleinen Jungen verstehen. Wenn die Anforderungen groß werden und die Verantwortung schwer, denke ich auch manchmal: Jetzt wäre ich gerne ein armes blindes Mäuschen.
Wahrscheinlich teile ich diese Sehnsucht mit nicht wenigen, einfach keine Verantwortung tragen müssen, einfach nur da sein, ohne sich über Konsequenzen Gedanken machen zu müssen.
Dass das zwar ein Traum von uns Menschen ist, aber keine Möglichkeit, erzählt eine sehr alte Geschichte aus der Bibel.
Aber hören Sie selbst:
1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? 2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; 3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. 7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen den Bäumen im Garten. 9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. 11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? 12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. 14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. 17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. (1.Mose 3,1-9)
Adam und Eva leben unbeschwert im Paradies. Sie leben sogar in einer gewissen Unbewusstheit. Zumindest stört sie es nicht, dass sie nackt sind. So hätte es ewig weitergehen können, wäre da nicht die Schlange gewesen, die den Reiz der verbotenen Frucht geweckt hätte. Adam und Eva müssen sich entscheiden, ob sie von der Frucht essen wollen oder nicht. Damit sind sie schon mitten in der Herausforderung eines jeden Lebens, abwägen zu müssen, was ist richtig, was ist falsch. Sie müssen der Einflüsterung der Schlage widerstehen: „Sollte Gott wirklich gesagt haben…“
Nun sind Adam und Eva gefragt. Sie werden sich ihrer selbst bewusst, weil sie überlegen müssen, wie sie sich entscheiden. Das gehört wohl zum Selbstbewusstsein von uns Menschen dazu, sich gegenüber den Einflüsterungen des Lebens zu verhalten. Ich habe große Hochachtung vor Euch jungen Menschen. Ihr begegnet so vielen Ideen und Versprechungen für ein gelingendes Leben, viel mehr als in der Zeit als viele von uns jugendlich waren. Und dann müsst Ihr überlegen, was richtig oder falsch ist, was wirklich gut tut oder in eine Sackgasse führt.
Bei den vielen Möglichkeiten des Lebens und bei den unzähligen Einflüsterungen dieser Welt braucht es mutige und selbstbewusste Entscheidungen.
Adam und Eva entscheiden sich, von der Frucht zu essen, in der Hoffnung, klug zu werden, zu wissen, was gut und böse ist. Vielleicht weil sie wissen, dass wir das wirklich für das Leben brauchen, einen klaren Kompass von gut und böse. Denn das zu wissen, ist gar nicht immer so einfach, auch weil die Welt sehr kompliziert ist, und einfache Antworten den Problemen nicht gerecht werden.
Adam und Eva essen von der Frucht und sie nehmen wahr, dass sie nackt sind. Sie sehen sich und schämen sich und schützen sich. Offensichtlich gehört das auch dazu, wenn man sich seiner selbst bewusst wird, dass man dann sich auch anders wahrnimmt. Man spürt, wo man verletzlich ist und wo man Schutz braucht. Wenn Selbstbewusstsein mit einem gewissen Maß an Selbstkritik einhergeht, dann ist das mir sehr sympathisch. Menschen, die nur vor Selbstbewusstsein strotzen ohne einen Funken an Selbstkritik, sind mir eher unheimlich.
Adam und Eva wird bewusst, dass sie gegen ein Gebot Gottes gehandelt haben und wollen sich vor ihm verstecken. Sie hören seinen Ruf: „Wo bist du?“ Gott möchte, dass der Mensch, den er geschaffen hat, Verantwortung für sein Handeln übernimmt. „Mensch, wo bist du, wenn die Lebensgrundlagen dieser Welt zerstört werden?“ „Mensch, wo bist du, wenn andere mit Gewalt überzogen werden?“ „Mensch, wo bist du, wenn gespottet und gelästert wird?“
Adam wird von Gott zur Verantwortung gezogen und Adam reagiert, wie wir Menschen gerne reagieren. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, schiebt er die Schuld auf Eva und Eva auf die Schlange. Bei diesem Spiel macht aber Gott nicht mit. Denn Adam hätte die Möglichkeit gehabt, zu Eva „Nein“ zu sagen. Eva hätte die Möglichkeit gehabt, zur Schlange „Nein“ zu sagen. Mach es Dir also nicht zu leicht, Du hast immer auch die Möglichkeit „Nein“ zu sagen und nicht mitzumachen. Wir machen oft Sachen mit, bei denen wir eigentlich gar kein so gutes Gefühl haben. Wir machen mit, weil die anderen auch mitmachen. Aber gerade dann tut es gut, wenn jemand mutig „Nein!“ sagt. Wenn jemand den Mut hat, „nein“ zu sagen, kommen oft andere und sagen: „Ich bin dankbar, dass Du Nein gesagt hast. Ich hatte auch ein ungutes Gefühl.“
Freilich ist das anstrengend und man sehnt sich danach, ein armes blindes Mäuschen zu sein, keine Verantwortung zu haben. Doch Gott hat den Menschen in die Welt gestellt mit all ihren Herausforderungen und Mühen, damit er selbstbewusst, selbstkritisch und selbstverantwortlich Entscheidungen trifft.
Und wenn ich gefragt werde: „Mensch, wo bist du?“, will ich mich nicht verstecken, sondern aufrecht stehen, wahrscheinlich mit ein bisschen zitternden Knien, und sagen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir.“
Amen.